Knowledge Center
Bleib mit uns immer auf dem neuesten Stand der E-Mobilität. Wir freuen uns, unser Wissen und unsere Expertise im Bereich Elektromobilität mit dir zu teilen.

Blog
Vehicle-Grid-Integration (VGI / V2G) Projekte: Was Kaffee, eine Insel und ein Fußballstadion gemein habenDie Energiezukunft begann bei uns mit einer Tasse Kaffee. Der Strom dafür kam allerdings nicht von einem weit entfernten Kraftwerk – sondern aus einem Elektroauto in der Tiefgarage. In dem ersten deutschen Vehicle-to-Grid-Piloten(V2G) überhaupt nutzten wir im Jahr 2015 die Batterie eines Nissan Leaf als zusätzlichen Energiespender für das Hausnetz seines Gebäudes. Das reichte zwar nicht für alle Verbraucher im Büro; für die Heißgetränke der Mitarbeiter:innen allemal.

Blog
Die interessantesten Elektroautos 2024Welche Elektroautos kommen in den nächsten Monaten auf den Markt? smart, Citroën, Audi, BMW? Welches Modell solltest du auf keinen Fall verpassen? Wir haben für dich erste Informationen mit Bildern, technischen Daten und Reichweiten der neuesten Elektrofahrzeuge.

Blog
Entscheidender Fortschritt: V2G als essenzielles Element der ElektromobilitätDas Jahr 2023 markierte einen Wendepunkt: Bidirektionales Laden in Deutschland nahm Fahrt auf. Durch unsere eigenen Projekte wurde bewiesen, dass die Ladetechnologie bereits heute erfolgreich funktioniert. Allerdings fehlen noch gesetzliche Rahmenbedingungen, die ihre praktische Anwendung ermöglichen. Diese sind unerlässlich, damit die Vehicle-to-Grid-Technologie losstarten kann. Die Politik hat die Dringlichkeit des Themas erkannt, nun bedarf es konkreter Massnahmen und klarer Signale. Die Zeit zu handeln ist jetzt.
Wir werfen einen Blick zurück auf die erzielten Fortschritte. Eines wird dabei klar: Wir befinden uns gerade erst am Anfang einer spannenden Phase auf dem Weg der bevorstehenden Energiewende.
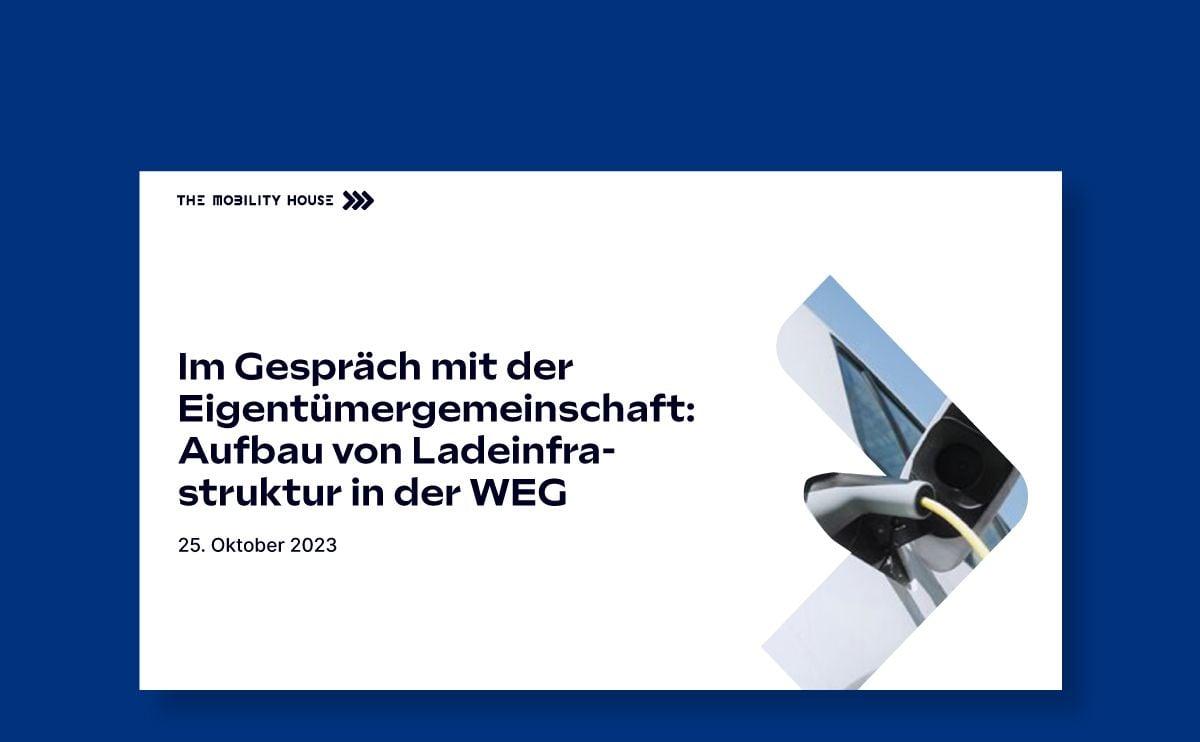
Webinar
Im Gespräch mit der Eigentümergemeinschaft: Aufbau von Ladeinfrastruktur in der WEG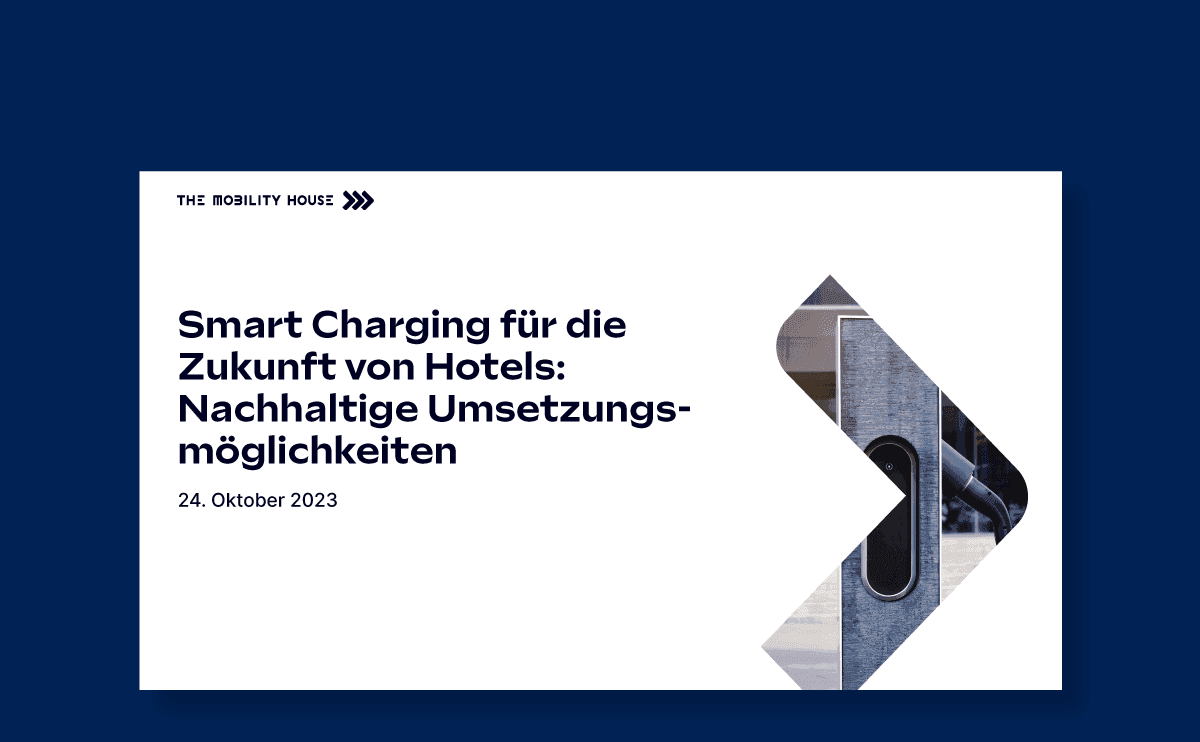
Webinar
Smart Charging für die Zukunft von Hotels: Nachhaltige Umsetzungsmöglichkeiten
Blog
Wallbox-Test von AUTO BILD und P3: die besten WallboxenAUTO BILD und die Technologie-Beratung P3 haben 10 Wallbox-Modelle getestet - hier die Ergebnisse.

Fahrzeug-Finder
Ladestationen passend zu deinem ElektroautoVergleiche Ladedaten verschiedener E-Fahrzeuge und finde die perfekte Wallbox für dein E-Auto.
Wir sorgen mit unserem Newsletter dafür, dass die Zukunft nicht an dir vorbeifährt: mit spannenden Infos rund um E-Mobilität. Jetzt anmelden.